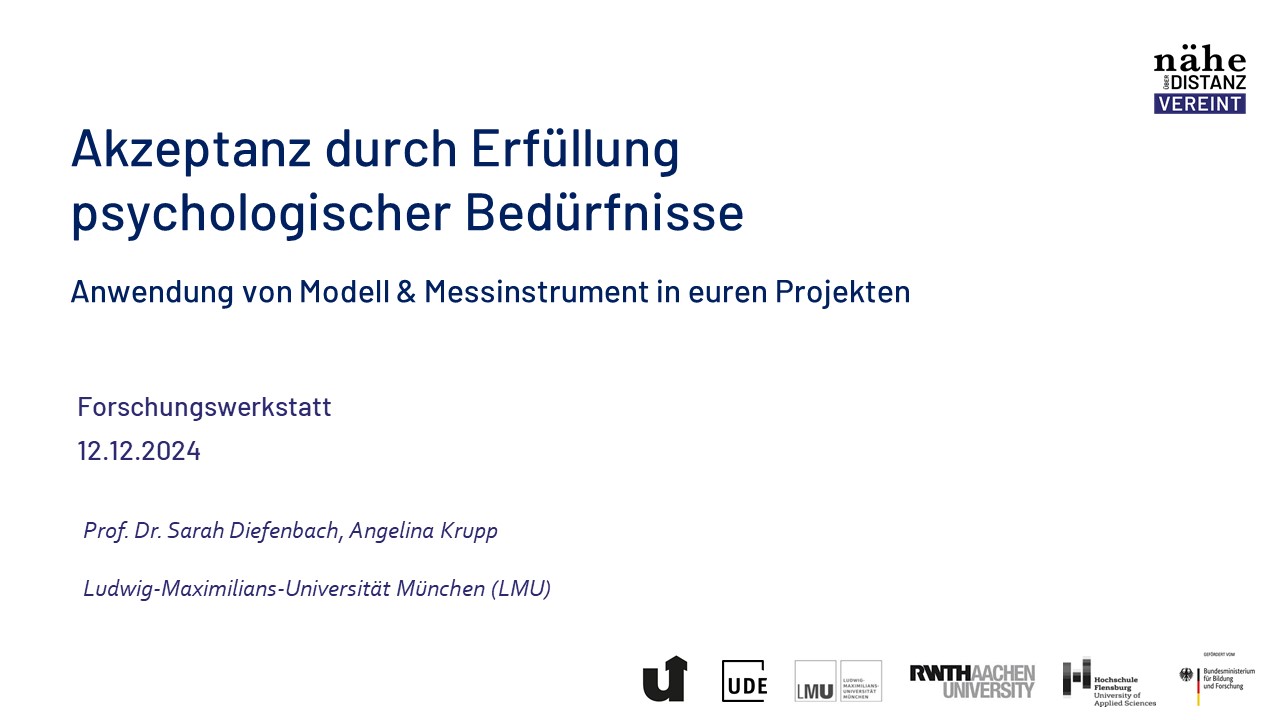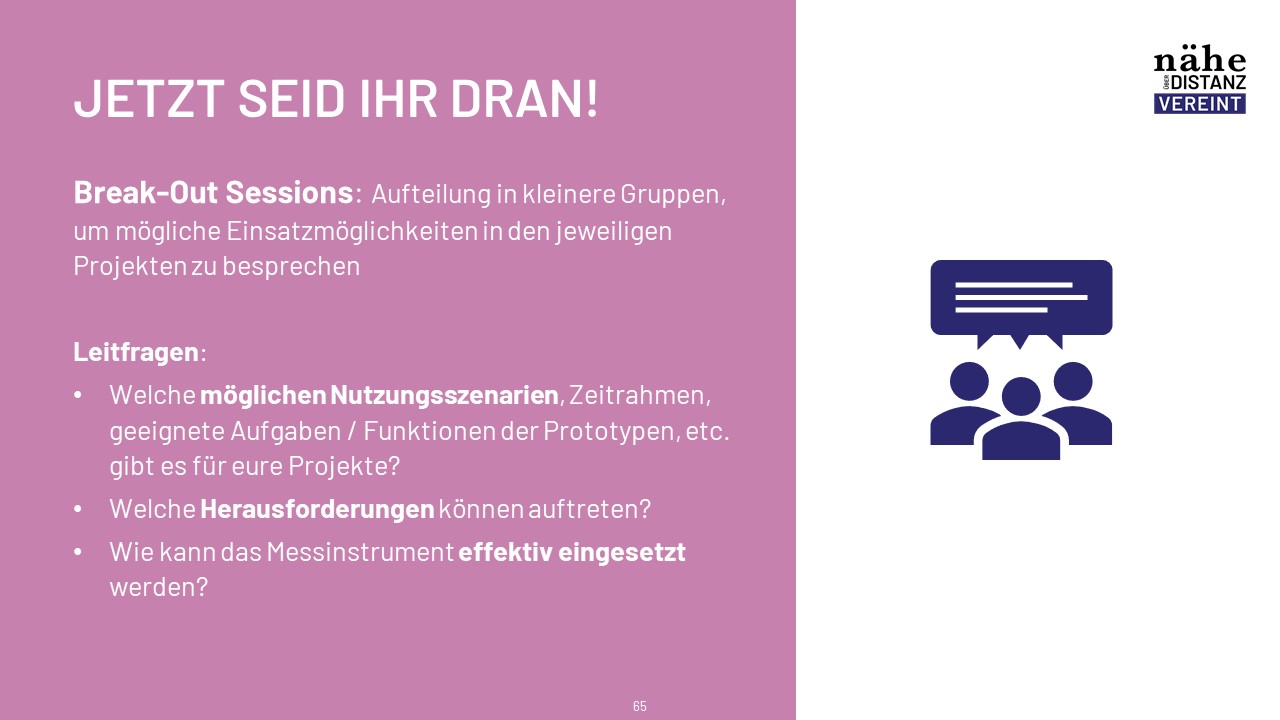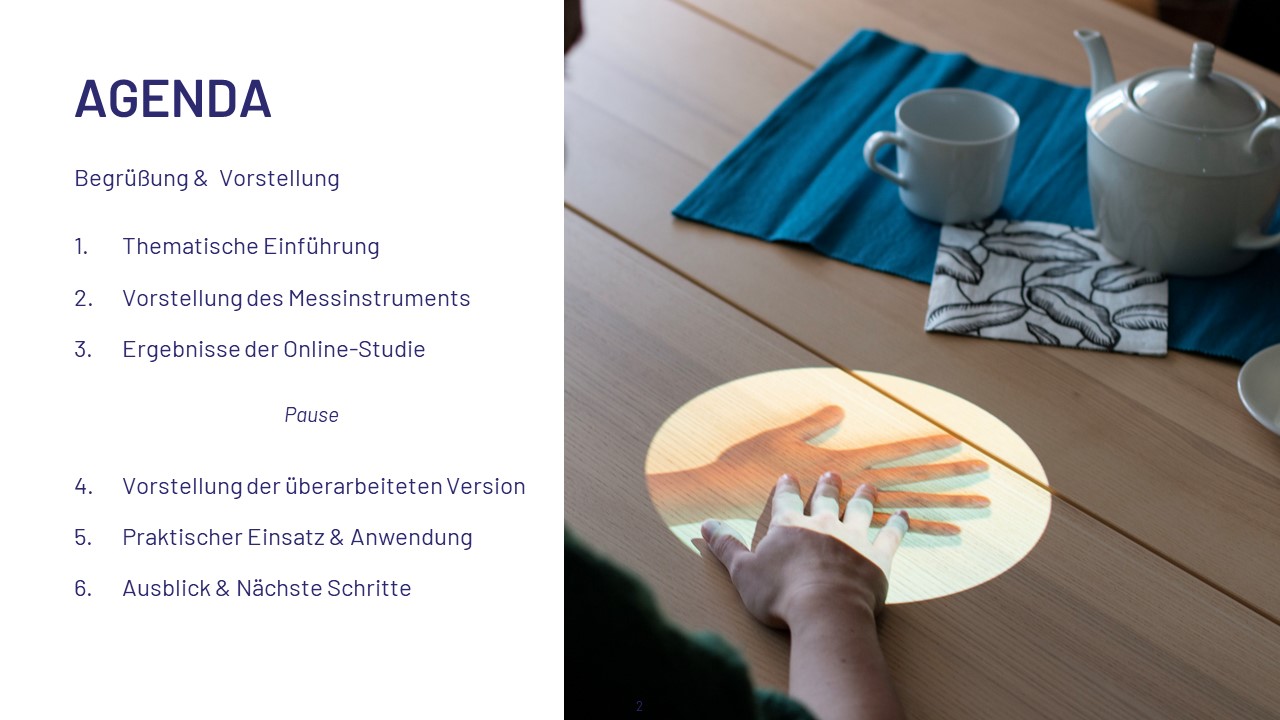Am 12.12.2024 fand die digitale Forschungswerkstatt „Akzeptanz durch Erfüllung psychologischer Bedürfnisse – Anwendung von Modell & Messinstrument in euren Projekten“ statt. Das Team der Ludwig-Maximilians-Universität München stellte darin eine erweiterte Perspektive auf das Thema Technologieakzeptanz vor, indem der Fokus auf der Erfüllung psychologischer Bedürfnisse liegt.

Illustration: Johanna Benz
Forschungsbedarf Technologieakzeptanz
Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellungsrunde startete die Forschungswerkstatt mit einer thematischen Einführung zu Technologieakzeptanz und dem aktuellem Forschungsbedarf. Anschließend wurde der geplante Forschungsansatz vorgestellt, der die Rolle positiver Nutzungserfahrungen betont und die Erfüllung psychologischer Bedürfnisse berücksichtigt. Durch die Unterteilung in ein Basis- und optionales Modul ist der Ansatz adaptiv und somit für verschiedene Technologien und Anwendungsbereiche einsetzbar.
Auf Grundlage empirischer Erkenntnisse einer Fokusgruppenstudie wurde die erste Version eines Akzeptanz-Fragebogens entwickelt und in einer Online-Studie evaluiert. Um herauszufinden, inwiefern die Erfüllung psychologischer Bedürfnisse zu Technologieakzeptanz (i.S.v. Nutzungsintention) beiträgt, wurden Proband:innen zu positiven und negativen Erfahrungen mit Technologien in ihrem Alltag befragt. Es wurde ein Überblick über die Ergebnisse der Datenerhebung gegeben und deren Bedeutung für die Überarbeitung und Weiterentwicklung des Messinstruments eingeordnet.
Akzeptanz-Fragebogen bestehend aus Basis-Modul und optionalem adaptivem Modul
Nach einer kurzen Mittagspause wurde die überarbeitete Version des Fragebogens vorgestellt. Diese umfasst ein Basis-Modul sowie ein optionales, adaptives Modul, das sich für die unterschiedlichen Technologien der Projekte anpassen lässt. Anschließend fand ein offener Austausch zum aktuellen Stand der Prototyp-Entwicklung statt, bei dem bisherige Studien und Erkenntnisse der Anwendungsprojekte berichtet wurden. Danach teilten sich die Teilnehmenden in Break-Out Sessions in kleinere Gruppen auf, um über mögliche Anwendungen des vorgestellten Messinstruments zu sprechen. Dabei standen Nutzungsszenarien und Funktionen der Prototypen sowie zusätzliche Faktoren, die speziell für die jeweiligen Technologien der Projekte von Interesse sein könnten, im Fokus. Die gesammelten Ideen und möglichen Einsatzszenarien wurden anschließend im Plenum vorgestellt und gemeinsam hinsichtlich ihrer praktischen Umsetzung diskutiert. Durch den Erfahrungsaustausch konnten spannende Einblicke gewonnen werden, die maßgeblich zur praxisnahen Weiterentwicklung des Messinstruments beitragen.
Herzlichen Dank für die aktive Teilnahme und die wertvollen Beiträge!